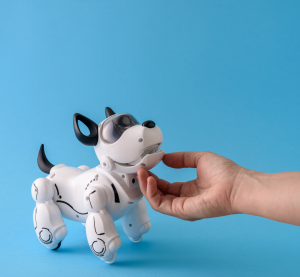Kollegin KI auf dem Hundeplatz?
KI könnte eingesetzt werden, das Miteinander von Mensch und Hund zu verbessern. Das verlangt Hundetrainer*innen noch mehr Fähigkeiten ab und geht mit neuen Risiken für die Qualität von Hundetraining einher. Was bedeutet das für das berufliche Trainieren von Hunden und ihren Menschen?
von Jenni Rotter
18. September 2025
Butter bei die Fische: KI ist gekommen, um zu bleiben. Die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten haben sich schon jetzt in vielen Arbeits- und Lebensbereichen so unersetzlich gemacht, dass Abläufe ohne sie kaum noch vorstellbar sind – oder zumindest nur sehr viel mühsamer denkbar: in der Automatisierung administrativer Aufgaben, im intelligenten Koordinieren zum Beispiel von Schichtplänen, in der Lagerlogistik oder sogar in ganz alltäglicher Kommunikation – von Orga-Aufgaben über lästige offizielle Mails bis hin zum Instagrampost nehmen Claude, ChatGPT und Konsorten den Menschen viele Aufgaben ab (und die populären Modelle am Markt tun das in der Regel durch Ausbeutung der Arbeit und Kreativität menschlicher Leistung, unter Verschwendung unglaublich vieler wertvoller natürlicher Ressourcen – aber das ist Thema für einen anderen Text).
Und auf dem Hundeplatz? Claude kann schwerlich mit der Kundin und ihrem Hund in Gummistiefeln auf der herbstlich-matschigen Hundewiese trainieren. Hundetraining ist Handwerk und digital nicht abbildbar.
Oder?
KI in der Hundeforschung
Geht man in die Recherche zu dem Thema (oder lässt Consensus, ChatGPT und NotebookLM die Recherche übernehmen und sortieren), findet man vor allem eins: unglaublich viel Dynamik. Und zwar sowohl in der (Grundlagen-)Forschung als auch in der angewandten (Trainings-)Praxis. Die Frage ist nicht mehr, ob KI auf das Zusammenleben und Arbeiten mit Hunden Einfluss haben wird, sondern nur noch: wie – und was das für Trainer*innen bedeutet. Die möglichen Entlastungen durch eine künstliche Assistenz gehen allerdings auch mit Risiken für die Qualität von Training und damit die Lebensqualität von Hunden einher. Aber werfen wir zunächst einen Blick in die Forschung: Forscher*innen weltweit arbeiten bereits daran, maschinelles Lernen für die Analyse und Vorhersage von Hundeverhalten zu nutzen – mit teilweise beeindruckenden Ergebnissen.
C-BARQ, KI und hündische Persönlichkeiten
Eine Studie mit über 600 Labrador Retrievern der amerikanischen Transportsicherheitsbehörde zeigte etwa, dass Algorithmen relativ präzise vorhersagen konnten, welche Hunde für ein spezielles Ausbildungsprogramm für Spürhunde geeignet waren. Die Untersuchung identifizierte wichtige Verhaltensmerkmale wie Geruchssinn, die für die Auswahl dieser Arbeitshunde entscheidend sind. Bei der Vorhersage, welche Hunde ausscheiden würden, war das Modell zwar nicht treffsicher, aber es konnte mit bis zu über 80%iger Genauigkeit prognostizieren, welche Hunde ausgewählt werden würden. Angesichts der hohen Ausbildungskosten für Arbeitshunde und die ebenfalls hohe Rate an Hunden, die im Laufe einer Ausbildung ausscheiden, sind solche Ergebnisse mit der Hoffnung verbunden, Hunde künftig effizienter, verlässlicher und kostensparender auf bestimmte Eignungen testen zu können.
Ähnlich vielversprechende Ergebnisse erzielte eine vergleichbare Studie zur potenziellen Eignung von Assistenzhunden. Für diese Studie trainierten Wissenschaftler*innen KI-Modelle mit Daten von C-BARQ, einer schon vergleichsweise alten und etablierten Methode der standardisierten Datenerhebung mit dem Ziel, hündische Persönlichkeitsmerkmale (und ursprünglich die Häufigkeit von Verhaltensstörungen) zu erfassen: dem Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire. Der umfangreiche Fragebogen erfasst Informationen zu unterschiedlichen Aspekten von Aggressionsverhalten bis Trainierbarkeit. C-BARQ ist auch relevant in einer weiteren Studie, die untersucht hat, ob Persönlichkeitstypen von Hunden mit KI bestimmt werden können. Tatsächlich konnten in jener Studie fünf verschiedene Persönlichkeitstypen identifiziert werden. Mithilfe der Algorithmen wurden beispielsweise zutreffend Hunde in Kategorien wie „erregbar“ oder „ängstlich/furchtsam“ eingeteilt. Die Vorhersagen waren dabei je nach verwendetem KI-Modell bis zu 99% korrekt.
KI und Hunde-Kommunikation
Gleich zwei Studien haben sich zuletzt damit auseinandergesetzt, wie man die Gesichtsausdrücke von Hunden automatisiert erkennen und interpretieren kann, um besser zu verstehen, was sie fühlen oder wie es ihnen gerade geht. Das zugrundeliegende Datenset, nämlich das Dog Facial Action Coding System DogFACS, ist genau wie C-BARQ lange etabliert. Aber: Die Anwendung und Auswertung durch Expert*innen musste bisher mühsam und zeitaufwändig per Hand (oder besser per Blick) aus Videos erfolgen – das ist umständlich und fehleranfällig. Da lag es nahe, zu testen, ob KI diese Aufgabe zuverlässig übernehmen kann. Die Antwort ist: Sie kann. Für die Analyse benutzten die verwendeten Algorithmen definierte „Gesichts-Landmarken“ (eben die DogFACS) – das sind 46 spezielle Punkte, die auf dem Hunde-Gesicht markiert werden, ähnlich wie kleine Ankerpunkte. Diese Punkte helfen zu verfolgen, wie sich das Gesicht bewegt. Unter anderem wurden nach hinten gelegte Ohren und geöffnete Maulspalte als sehr zuverlässige Indikatoren für Furcht (bei Feuerwerk) identifiziert.
…und in der Praxis?
Das Potenzial für Anwendungen in der Praxis liegt auf der Hand: KI-Hilfe bei der Anamnese neuer Hunde nicht nur für Trainer*innen, sondern auch zum Beispiel für Tierheime, die die Fehlerquote bei Vermittlungen verringern wollen und nicht die Zeit haben, jeden hündischen Neuzugang auf Herz und Nieren und Persönlichkeit zu testen. Ein effizienteres, kostensparendes Matching von Hunden für bestimmte Jobs. Unterstützung für Hundehalter*innen, ihre Hunde besser lesen und verstehen zu lernen – quasi ein Übersetzungsservice für Hundesprache und -verhalten. Aber auch zum Beispiel automatisierte Verlaufsdokumentationen von Trainingsentwicklungen oder Tracking und Interpretation von Datenpunkten, die Rückschlüsse auf Verhalten erlauben. Aus Bell- und Bewegungsmustern könnte beispielsweise im Tagesverlauf vergleichsweise objektiv und konsistent herausgelesen werden, welches Problemverhalten vorliegt, und eine gut trainierte KI könnte Empfehlungen für das weitere Vorgehen geben.
Entsprechend lang ist die Liste der Treffer, wenn man bei Google nach „KI Hundetraining“ oder vergleichbaren Begriffen sucht. Mehrere Apps, Wearables wie „Smart Dog Watches“ und Softwares versprechen maßgeschneidertes Hundetraining, bequeme Begleitung von zu Hause aus, quasi eine*n Hundetrainer*in für die Hosentasche, KI-basierte Hundetrainer*innen-Ausbildungen oder sogar eine Art KI-Dogsitter, der dem Hund in Abwesenheit der Halter*innen kleine Aufgaben stellt. Bei genauerem Blick sind viele der bunt und laut beworbenen Angebote allerdings entweder gar nicht KI-basiert, noch in Testphasen, Beta-Modelle oder gar erst in Ankündigung (Jetzt vorregistrieren!).
Alternativ kann man ChatGPT und vergleichbare Angebote mit einem gut formulierten Prompt – also dem Arbeitsauftrag an die KI – um die Erstellung von Trainingsplänen bitten. Der Selbstversuch zeigt: Das Ergebnis ist gar nicht schlecht. Bei einem durchschnittlichen Hund und mit etwas Glück könnte zum Beispiel der angebotene Trainingsplan für das Üben von Alleinbleiben durchaus von Erfolg gekrönt sein.
Ist also die Zeit menschlicher Trainer*innen vorbei?
Die Übersicht liest sich beeindruckend. Und kann den Eindruck erwecken, dass die künstliche Hundetrainerin schon morgen auf allen Smartphones zur Verfügung steht. Ganz so simpel ist der Transfer von Forschung und Entwicklung in die Praxis aber nicht.
So zeigte sich beispielsweise bei den Arbeiten rund um DogFACS, dass die Vielfalt hündischen Aussehens der Treffsicherheit von Vorhersagen zum Teil empfindliche Einbußen bescherte. Soll KI aber verlässlich unterstützen, muss die Aussage, ob ein Hund Angst hat oder beispielsweise Aggression zeigt, beim langhaarigen, schlappohrigen Spaniel genau so korrekt sein wie beim pommestütenohrigen Malinois, und muss die KI in der Lage sein, auch den einen charakterlichen Ausreißer unter 100 rassetypischen Beaglen zuverlässig zu bestimmen. Bislang ist das nicht gegeben. Verhaltens- und Persönlichkeitsanalysen treffen bisher auf Grenzen in der Genauigkeit ihrer Vorhersagen.
Einer der Gründe: Die Algorithmen brauchen noch wesentlich mehr Daten – und vor allem Menschen, die ihnen „gute“ Daten füttern. Das könnte eines der anhaltendsten Probleme werden. Denn die Antworten von KI sind immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie gelernt haben. Wir wissen aus anderen Bereichen, dass KI die Vorurteile und Fehlwahrnehmungen von Menschen übernehmen kann. Das Ergebnis sind zum Beispiel rassistische oder frauenfeindliche KI.
Übertragen auf Themen von Hundetrainer*innen könnte das beispielsweise bedeuten, dass bestimmte Trainingsmethoden bevorzugt empfohlen werden, obwohl die Evidenz es eigentlich nicht hergibt, aber die Methode aktuell im Trend ist (=und deswegen mehr Quellen zum Lernen verfügbar sind). Oder dass für manche Hunderassen (zu Unrecht) Vorgehensweisen auf Basis von Rassestereotypen empfohlen werden, weil die KI es schlicht falsch gelernt hat. Nicht zuletzt gibt es immer das Risiko von KI-„Halluzinationen“: „Weiß“ die KI etwas nicht, denkt sie sich je nach Prompt und Rahmenbedingungen Inhalte mitunter aus: Sie “lügt”.
Eine weitere Tücke: KI gibt wenig Widerworte. Je nach Arbeitsauftrag und definierter Rolle tendiert sie momentan (noch?) dazu, den Standpunkt der nutzenden Person zu stärken, auch, wenn dieser falsch oder destruktiv ist. Einer falschen Überzeugung zu Trainingsschritten wird die KI eventuell keine Gegenargumente entgegensetzen. Damit besteht auch das Risiko, dass sie möglicherweise nicht neutral bleiben würde, wenn ein Mensch Hundeverhalten falsch interpretiert. Könnte man die KI mit suggestiven Fragen dazu bringen, sich der Fehlwahrnehmung anzuschließen und ggf. tierschutzwidrige Handlungen zu rechtfertigen? Vermutlich.
Und das Beispiel „Trainingsplan fürs Alleinbleiben von ChatGPT“ zeigt einen weiteren Fallstrick: Der irgendwie schon ganz passable Trainingsplan ohne offensichtliche Schnitzer hatte ein großes Defizit: Vagheit – und dadurch großes Potenzial für Fehler durch den umsetzenden Menschen. „Wenn Dein Hund entspannt ist, belohne ihn“ kann so viele unterschiedliche Dinge bedeuten und setzt ein derartiges Wissen über Ausdrucksverhalten von Hunden voraus, dass ein Mensch ohne Vorerfahrung mit großer Wahrscheinlichkeit Fehler machen würde.
Vermutlich eher (krasse) Evolution statt Revolution
Natürlich werden KI besser werden. Und vermutlich liegen zum Beispiel KI-gestützte Videoanalysen oder standardmäßig mit Hilfe von Algorithmen erstellte Trainingspläne für den „Hausgebrauch” durch Hundetrainer*innen oder Privatpersonen nicht mehr in allzu ferner Zukunft. Es ist möglich, dass die Rolle von Hundetrainer*innen sich verändert: nicht mehr unbedingt alleinige ausführende Trainings-Fachperson, sondern steuernde und Kontext gebende Instanz für zum Teil automatisierte Anamnesen und Trainingspläne. KI-gestützte Analysen könnten objektivere Leistungsbewertungen erlauben, Arbeitsbelastung verringern und bei der frühen Erkennung von Potenzialen und Problemen der betreuten Hunde unterstützen.
Vielleicht liegen wir auch komplett daneben mit unserer Prognose, weil der durch KI gebrachte Wandel zu tiefgreifend ist, um seine Auswirkungen auf unsere Zunft zum jetzigen Zeitpunkt auch nur ansatzweise erfassen zu können. Nach aktuellem Stand aber sieht es so aus: Die Zukunft gehört wahrscheinlich nicht der KI oder dem Menschen allein, sondern dem Team aus beiden – mit dem Menschen als „Dirigent“ und der KI als präzisem Analyse- und Planungswerkzeug.
Menschliche Kompetenz wird noch wichtiger
Das bedeutet auch, dass die Kompetenzen von Hundetrainer*innen vorerst nicht weniger wichtig werden, sondern im Gegenteil an Bedeutung gewinnen: Je mehr wir uns auf technische Hilfsmittel verlassen, desto sicherer müssen wir in unserer Fähigkeit zur (selbst)kritischen Beobachtung und Wahrnehmung von Fehlern sein. Und vermutlich wird zusätzlich auf absehbare Zeit die Sensibilisierung von Kund*innen gegenüber den Fallstricken von “Training nach ChatGPT” relevanter werden, wenn es nicht mehr nur heißt “also ich habe das gegoogelt und dieser eine Trainer auf Youtube sagt…”, sondern nun auch zunehmend “Ich habe ChatGPT gefragt, wie ich das trainieren soll”.
Die “neue Kollegin KI” entlastet also nicht einfach bequem oder ersetzt gar menschliche Expertise, sondern verlangt Trainer*innen im Prinzip zunächst noch mehr Fähigkeiten ab – didaktische Kompetenz, kynologisches Wissen und bis zu einem gewissen Grad neues technisches Know How.
Den meisten Nutzen werden vermutlich diejenigen haben, die in der Lage und bereit sind, ihre Werkzeuge für die eigenen Bedarfe anzupassen und zu pflegen. Denn da die KI immer nur so gut ist wie die “Ausbildung”, die sie bekommen hat, leistet sie bessere Dienste, wenn sie gut trainiert ist. Will man KI also sinnhaft als Assistenz nutzen, muss man auch Zeit in ihre Ausbildung investieren – indem man gute Daten “füttert”: beispielsweise eigene Fallbeispiele, Veränderungs-Protokolle und Trainingspläne, verbunden mit Bewertungen, was gut lief, was keinen Erfolg brachte, usw. So kann das Risiko für “falsche Daten” minimiert und die Kontrolle über die Qualität der Ergebnisse erhöht werden. Aber eben nur dann, wenn die eigenen Eingaben stimmen: Je kompetenter der*die einspeisende Hundetrainer*in, desto besser wird die Assistenz. Die Unterstützung durch KI entlässt uns also bis auf Weiteres nicht aus der Pflicht und Kür der menschlichen Qualitätskontrolle.
KI auf der KynoKon
Wer mehr über KI und Hunde(forschung und praxis) lernen will, sollte bei der KynoKon vom 6. bis 8. Oktober dabei sein: KI in Forschung und Arbeit mit Hunden ist eines der Themen. Der Verhaltensbiologe Dr. Christoph Völker stellt seine Arbeit mit KI vor, die Verhaltensbiologin und Hundetrainerin Dr. Annika Bremhorst, die beispielsweise an einer der zitierten DogFACS-Studien mitgearbeitet hat, berichtet über ihre neueste Forschung.
Tickets für die Veranstaltung vor Ort oder für den Live-Stream online gibt es auf der Website der KynoKon.
Quellen:
Machine learning prediction and classification of behavioral selection in a canine olfactory detection program: https://www.nature.com/articles/s41598-023-39112-7
Prediction of assistance dog training outcomes using machine learning and deep learning models: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159125001303
Über C-BARQ (englisch): https://vetapps.vet.upenn.edu/cbarq/about.cfm
An artificial intelligence approach to predicting personality types in dogs: https://www.nature.com/articles/s41598-024-52920-9
Dog facial landmarks detection and its applications for facial analysis: https://www.nature.com/articles/s41598-025-07040-3
Automated Analysis of Emotional Expressions in Dogs based on AI-Enhanced Geometric Morphometrics: https://www.researchgate.net/publication/391422847_Automated_Analysis_of_Emotional_Expressions_in_Dogs_based_on_AI-Enhanced_Geometric_Morphometrics
AI generates covertly racist decisions about people based on their dialect: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07856-5
Gender biases within Artificial Intelligence and ChatGPT: Evidence, Sources of Biases and Solutions: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949882125000295